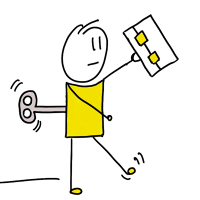In diesem Blogreihe werden ich wesentliche Erkenntnisse der Neurobiologie und der Neuropsychologie herauszuarbeiten, die für Lernen und Lehren relevant sind.
Teil 2: Lernen und das Unterbewusstsein
„Es ist nicht leicht sich vorzustellen, dass ein Wesen denken kann, ohne zu merken dass es denkt.“[1]
Diese Feststellung über den Zusammenhang zwischen Denken und Bewusstsein hat der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz schon Anfang des 18. Jahrhunderts gemacht. Manfred Spitzer vermutet, dass die Untersuchung des Unterbewusstseins lange kein hochgeschätzter Teil der Wissenschaften war, da man die Vorstellung nicht mochte, dass in uns ein Geist arbeitet, den man nicht wahrnimmt und damit auch nicht kontrollieren kann. Dieses Prinzip stellt das Konzept des freien Willens in Frage.[2]
Gibt es den freien Willen wirklich?
Heute beschäftigt man sich auch noch mit dem Element des freien Willens, allerdings ist die Forschung rund ums Unterbewusstsein ein wichtiger Zweig geworden, um nicht zu sagen, es sei trendy in diesem Bereich zu arbeiten. Besonders die Werbung beschäftigt sich schon lange mit dem Käuferinnenverhalten, um herauszufinden, wie und wann Kunden kaufen und welche äußeren Reize ihr Verhalten beeinflussen können.
Wie unterscheiden sich bewusstes und unterbewusstes Denken? Bewusstes Denken wird gelenkt, ist sehr fokussiert und arbeitet eher konvergent. Im unterbewussten Denken laufen Prozesse unbemerkt ab, sind weniger fokussiert und eher divergent. Das Unterbewusstsein arbeitet, ohne dass der Mensch es mitbekommt und bringt dennoch Ergebnisse. Zum Beispiel kann die Aussage „Schlaf noch eine Nacht darüber“, durch neurowissenschaftliche Untersuchung bestätigt werden. Ein anderes Phänomen, das viele Menschen schon persönlich erlebt haben, ist dass man sich in sein Problem hineindenkt, grübelt, studiert und einfach nicht auf die Lösung kommen will. Dann lässt man es gut sein, widmet sich anderen Dingen und am nächsten Tag beim Zähneputzen, im Bus oder beim Staubsaugen hat man plötzlich die Lösung parat und sieht sie klar und deutlich vor sich. Man spricht dabei auch von Inkubation; das Gehirn „brütet“. Da es nicht absehbar ist, wann und wie es zu einer Lösung kommt, sind diese Phänomene eher schwer zu untersuchen, dennoch wurde es in unterschiedlichen Forschungen versucht.[3]
Wo ist das Bewusstsein zu Hause?
Das Bewusstsein spielt sich in einigen Teilen des Neokortex ab, einer dünnen Schicht, die die anderen Gehirnareale ummantelt. Das Unterbewusstsein liegt in den subkortikalen Arealen. Wenn also unterbewusste Gedanken das Bewusstseinszentrum erreichen wollen, müssen sie bis zum Präfrontalkortex aufsteigen. Dort ist der Sitz des Kurzzeitgedächtnisses. Da der Arbeitsspeicher des bewussten Denkens viel kleiner ist als das Zentrum fürs Unterbewusstsein, wird vom Gehirn ausgewählt, was ins Bewusstsein vorrücken soll.[4]
In einer von Professor Wagner durchgeführten Studie machten Versuchspersonen eine Übung, in der es um Reaktionszeit ging. Die Probandinnen wussten aber nicht, dass in der Aufgabe eine Regel versteckt war. Die Übung wurde mehrmals wiederholt. Eine Gruppe konnte während der Übungen schlafen, die andere Gruppe nicht. Bei den Versuchspersonen die geschlafen hatten, kamen ca. 60% auf die verstecke Regel, bei den andern nur 20%. Die Forscher lasen aus diesen Ergebnissen, dass durch das nochmalige Durchspielen der Übung im Schlaf einerseits das Wissen gefestigt wird (das geschieht im Hippocampus und im Neokortex) und andererseits im Schlaf eine geistige Umstrukturierung stattfindet, was wiederum den Weg frei macht für Einsicht.[5]
Kann das Unterbewusstsein besser mit Komplexität umgehen?
Eine Studie von Sozialpsychologe und Intuitionsforscher Ap Dijksterhuis beschäftigte sich mit der Komplexität von Aufgaben in Kombination mit der Treffsicherheit des Unterbewusstseins. Dabei kamen die Wissenschaftlerinnen zu dem Ergebnis, dass bei vielschichtigen Aufgaben das unterbewusste Denken eine sehr hohe Trefferquote hat. Es gab insgesamt 4 Versuchsgruppen. Jeweils 2 Gruppen mussten aus mehreren Autos das beste auswählen (der Versuch hat eine eindeutige Lösung vorgesehen). Es gab eine Gruppe mit der Aufgabe, aus 4 Autos mit jeweils 4 Parametern das beste auszuwählen und eine weitere Gruppe, die aus 4 Autos mit jeweils 12 Parametern das beste auswählen musste. Die Gruppen wurden dann ein weiteres Mal unterteilt. Eine Einheit hatte die Aufgabe, über die Fragestellung nachzudenken und die Aufgabe zu lösen. Die andere Einheit hatte Zeit, sich die Aufgabe genau anzuschauen und musste dann Bilderrätsel lösen. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Teilnehmer nicht aktiv über das Problem nachdenken konnten. Die Ergebnisse waren spannend und signifikant. Bei einer eher leichten Aufgabenstellung konnte das Bewusstsein eine gute Lösung erzielen, wohingegen bei einer komplexeren Aufgabenstellung das Unterbewusstsein eine signifikant bessere Lösung erzielte (siehe Tabelle).[6]
| Untersuchungs-ergebnis | Gruppen: Bewusstes Nachdenken über die Aufgabenstellung | Gruppe: Aufgabe erfassen und Bilderrätsel lösen |
| 4 Autos mit 4 Attributen | 54% | 42% |
| 4 Autos mit 12 Attributen | 23% | 60% |
Laut dem Forscherteam sind für dieses Ergebnis 3 Bedingungen wichtig:[7]
- Anfänglich ein bewusstes Auseinandersetzen mit der Aufgabenstellung; ein Sammeln der Fakten.
- Phase der Informationsaufnahme soll mit dem Hinweis abgeschlossen werden, dass und wann eine Wiederaufnahme mit der Beschäftigung des Problems beginnt.
- Während der Inkubationszeit ein ablenkende, aber intellektuell und emotional nicht zu schwierige Aufgabe.
Das Forschungsteam um Ap Dijksterhuis hat in einem weiteren Schritt versucht, diese Untersuchung in ein lebensnahes Umfeld zu bringen. In einer Voruntersuchung wurde der Komplexitätsgrad für Produkte festgestellt. Anhand dieser Liste wurden zwei schwedische Geschäfte ausgesucht. In einem Kaufhaus gab es Küchenbedarfsartikel, die einen geringen Komplexitätsgrad (z.B Shampoo, Schuhe) aufwiesen und in einem Möbelhaus gab es Artikel mit einem hohen Komplexitätsgrad (z.B Bett, Schrank).[8]
Die erste Befragung fand direkt vor dem Geschäft statt. Untersucht wurde, um welches Produkt es sich handelte, wie teuer es war, ob die Personen das Produkt kannten bevor sie es gekauft hatten und wie oft sie vor dem Kauf über das Produkt nachgedacht hatten. Personen, die das Produkt erst beim Kauf kennenlernten, schieden aus der Untersuchung aus. Nach einigen Wochen wurden die Personen wieder kontaktiert um herauszufinden, wie zufrieden sie mit dem Produkt waren. Es stellte sich dabei heraus, dass Kunden aus dem Möbelhaus (komplexe Produkte) dann zufriedener mit dem Produkt waren, wenn sie weniger aktiv darüber nachgedacht hatten, wohingegen bei den einfachen Produkten bewusstes Nachdenken und die Zufriedenheit einen höheren Wert erzielten.[9]
Es gibt noch viele weitere Untersuchungen, die sich mit dem Unterbewusstsein beschäftigen. Zusammenfassend kann über diese Ergebnisse gesagt werden, dass es ein Zusammenspiel zwischen bewusstem und unterbewusstem Denken geben soll, um es optimal zu nutzen. So ist es wichtig, dass wir vorsätzlich Informationen über ein Thema einholen und ein bisschen darüber grübeln. Es kommt danach aber der Zeitpunkt, wo wir uns unseren unterbewussten Gedanken überlassen und unser aktives Hirn einmal ruhen lassen. Das Zusammenspiel von beiden bringt uns zu einer guten Lösung.
Fazit für TrainerInnen
- Den Teilnehmerinnen das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein erklären.
- Beim Erklären von Inputs genügend Zeit geben, dass die einzelnen Inhalte aufgenommen werden können.
- Nach theoretischen Inputs Aktivierungsübungen und Spiele ansetzen
[1] Spitzer, 2007, S. 30.
[2] Spitzer, 2007, S. 29f.
[3] Spitzer, 2007, S. 54ff.
[4] Lang, Hütter, TA, 7/2014, S.15
[5] Spitzer 2007, S. 55 ff.
[6] Lang, Hütter, TA, 7/2014, S.16.
[7] Lang, Hütter, TA, 7/2014, S.16.
[8] Spitzer, 2007, S. 59 ff.
[9] Spitzer, 2007, S. 60 ff.